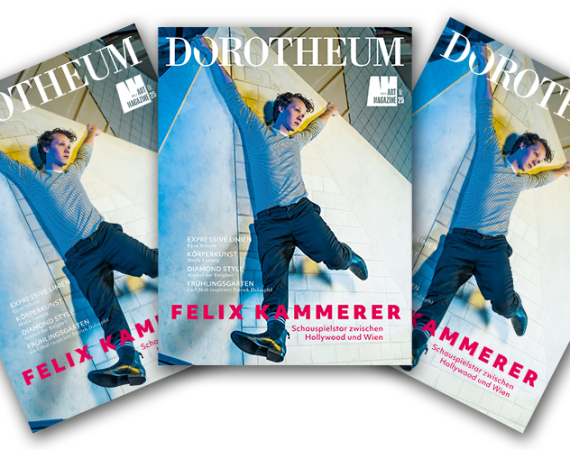Von opulenten Blumenarrangements über reich gedeckte Tafeln bis hin zu Vanitas- oder Trompe-l’œil- Darstellungen: Die Stilllebenmalerei erfreute sich über Jahrhunderte im gesamten europäischen Raum größter Beliebtheit. Stillleben dienten nicht nur der Wiedergabe kostbarer Dinge, sondern sprachen in komplexen Symbolen. Der Versuch einer Dechiffrierung anhand eines Gemäldes von Jan Brueghel II.
1 DAS TICKEN DER ZEIT
Mit dem Verweis auf die Vergänglichkeit allen Irdischen ist die Uhr ein klassisches Vanitas-Motiv. Der Zeiger weist auf zwölf, das Ende des Tages – was als Metapher für die Endlichkeit menschlichen Lebens steht. Diese Darstellung einer Taschenuhr mit dem am Stoffband hängenden Aufziehschlüssel gehört zu den frühesten ihrer Art. Uhren, die sich tragen ließen – von Männern an einer Kette in einer Hosen- oder Jackentasche, von Damen an einer Kette um den Hals oder an der Taille –, waren im 17. Jahrhundert exklusive Prestigeobjekte.
2 BLUME DER ERINNERUNG
Seit dem 15. Jahrhundert ist das Vergissmeinnicht unter seinem volkstümlichen Namen bekannt. In althochdeutschen Schriften begegnet zudem die Bezeichnung fridiles auga („Auge der Geliebten“), die bereits auf seine Bedeutung als Blume der Liebenden verweist. Im christlichen Volksglauben wiederum wurde die Legende tradiert, Christus habe, auf dem Schoß Mariens sitzend, in ihre Augen geblickt und sich gewünscht, dass auch zukünftige Generationen diesen Anblick teilen könnten. Daraufhin habe er ihre Iris berührt und über die Erde gestrichen, aus der sogleich die blauen Blüten des Vergissmeinnichts sprossen. Beide Überlieferungen begründen die Symbolik der Pflanze als Zeichen von Treue, Liebe und wertvoller Erinnerung.
3 OPULENTER BLÜTENZAUBER
Die mit Ornamenten verzierte und vergoldete Tazza zeugt von kunsthandwerklicher Meisterschaft. Prunkschalen dieser Art dienten meist der Darbietung von Wein oder Delikatessen wie kandierten Früchten. Gekrönt wird das Gefäß von einem opulenten Kranz aus Nelken, Rosen, Veilchen, Blausternen, Narzissen, Ringelblumen, Stiefmütterchen, Ranunkeln, Immergrün, Vergissmeinnicht und weiteren Blüten – einer botanischen Vielfalt von Blumen, die in der Natur niemals gleichzeitig und am selben Ort in Blüte gestanden wären. Die Pracht ist Ausdruck der kosmischen Schöpfung und des weltlichen Reichtums in einer Epoche, in der für Blumensamen Unsummen bezahlt wurden. In der christlichen Symbolik wurde der Blumenkranz traditionell mit Keuschheit und Jungfräulichkeit assoziiert, einzelne Blüten wie die Ringelblume, die Rose und das Immergrün sind dezidiert marianische Symbole.
4 GEFAHR IM PARADIES
Die kleine, kaum auffällige Wespe zwischen den Blüten erinnert daran, dass selbst inmitten prachtvollster Schönheit das Vergängliche und das Gefährliche gegenwärtig sind. Sie fungiert als Vanitas-Symbol und verweist auf die Dichotomie der Natur zwischen Schönheit und Verfall.
5 EDLE STEINE
Auf dem leuchtend roten Tuch erstrahlen Fingerringe mit farbigen Edelsteinen und daneben Diamanten. Antwerpen, wo das Gemälde entstanden sein dürfte, galt seit dem 16. Jahrhundert als wichtigstes Zentrum des Diamanthandels. Zwar war der moderne Brillantschliff in Brügge entwickelt und in der Region Kempen verfeinert worden, doch profitierte Antwerpen von seiner günstigen Lage und dem wichtigen Binnenhafen.
6 BAROCKER LUXUS
Besonders kostbar ist die schwarze, mit Kirschzweigen und -blüten verzierte Lackschatulle, ein Beispiel für die jahrtausendealte japanische Urushi-Kunst. Aufgrund des zeitintensiven Herstellungsprozesses zählten solche Lackarbeiten zu den erlesensten Luxusgütern. Ab dem 17. Jahrhundert gelangten sie in größerer Zahl nach Europa und fanden sich bald in den Sammlungen der wohlhabenden Klassen. In der Schatulle verwahrt ist eine kostbare Kette aus Naturperlen. Schmuckstücke daraus waren von der Antike an begehrt und wegen ihrer Seltenheit auch im 17. Jahrhundert hochgeschätzt. Vor allem von Frauen getragen, galten Naturperlen im christlichen Tugendkanon als Sinnbild der Reinheit und Jungfräulichkeit Mariens.
7 FRAGILE SCHÖNHEIT
Die Glasvase – hier beherbergt sie ein Sträußchen aus Tulpen, Schwertlilien, Narzissen und Nelken – hat laut der Symbolik der Stillleben eine besonders ambivalente Bedeutung: Sie steht einerseits für die Kostbarkeit und Kunstfertigkeit des venezianischen und böhmischen Glashandwerks, andererseits für die Zerbrechlichkeit des Daseins.
Die im Gemälde verorteten Symbole bergen im Sinne einer christlichen Deutung eine starke Vanitas-Motivik, die die Sinnlosigkeit menschlicher Ambitionen und der Anhäufung irdischen Luxus angesichts des unausweichlichen Todes betont. Eine weitere Bedeutungsebene tut sich mit dem Rückgriff auf marianische Symbolik in der Verbildlichung weiblicher Tugenden wie Reinheit, Treue und Keuschheit auf. Ebenso aber kann die Konservierung von Lebendigem und Kostbarem als Ausdruck künstlerischer Rebellion und somit als Triumph der Malerei über die Vergänglichkeit gedeutet werden.

AUKTION
Alte Meister
23. Oktober 2025
Palais Dorotheum, Dorotheergasse 17, 1010 Wien
oldmasters@dorotheum.com
Tel. +43-1-515 60-403