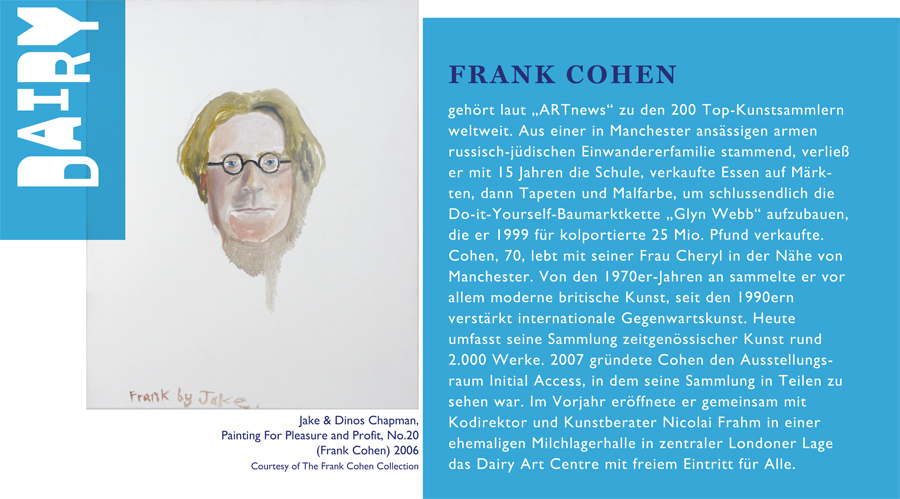Die Leidenschaft für das Sammeln wurzelt in meiner Kindheit. Ich habe als Kind Zigarettenbilder mit Fußballern oder Boxern gesammelt, später Münzen mit seltener Prägung. In den 1970er-Jahren lernte ich meine Frau Cheryl kennen; bei ihrem Vater, der damals Kunsthändler in Manchester war, kaufte ich Kunstdrucke in limitierter Auflage. Drucke sind Massenprodukte, reine Zeitverschwendung, also bin ich auf Originale umgestiegen.
Ein Gemälde mit dem Titel „Unsere Familie“, das ich bei einem Kunsthändler in Manchester um 1.100 Pfund erwarb. Es hatte die Größe einer Postkarte und stammte vom englischen Industriemaler L. S. Lowry. Von da an ging es weiter: Die Zigarettenbilder waren Schnee von gestern, die Münzen auch, ich war jetzt in der Kunstszene. Es war wie ein Virus, den ich nie mehr loswurde. Seitdem lese ich ständig über Kunst. Ich habe ja keine höhere Schulbildung, kein Kunstgeschichtestudium oder Ähnliches absolviert. Mein Geld verdiente ich in der Heimwerkerbranche: Badezimmer, Küchen, Teppiche … Damals nannte man das „DIY“ – „do it yourself“.

v.l.n.r.: Ugo Rondinone, Sunrise. East.November, 2017 | L.S. Lowry, Father & Two Sons, 950 | Tony Cragg, Fruit Bottles, 1989
Anfangs habe ich hauptsächlich Kunst gekauft, die das widerspiegelte, was ich in meinen Geschäften verkaufte – zum Beispiel von Arman. Ich hielt also nach Haushaltsgegenständen Ausschau, die Kunstwerken ähnelten, gemacht aus Materialien, die es in einem Baumarkt zu kaufen gibt.
Früher gab es die Aristokraten, die über Generationen bei den alteingesessenen englischen Händlern Kunst kauften. Uns blieb nur Lowry, aber den verstanden wir wenigstens. Wenn du versucht hast, diese Barrieren zu durchbrechen – ich zum Beispiel bin immer wieder nach London gefahren, um mitzumischen –, wurdest du einfach ignoriert. Sie musterten dich von oben bis unten, und wenn du mit Jeans und T-Shirt daherkamst, hielten sie dich für einen Idioten: Pech gehabt! Nur im Nadelstreifanzug mit Krawatte wurde man ernst genommen. Heute ist alles ganz anders: Bei denen mit T-Shirt und Sneakers sitzt die Geldbörse locker; die mit Nadelstreif und Krawatte drehen jeden Cent zweimal um. Es hat sich alles um 180 Grad gedreht, die Welt steht Kopf.
Heute ist mehr Geld im Spiel, besonders in London.
Russen, Chinesen, Südamerikaner, Leute aus Paris: Sie alle wollen wegen der niedrigen Steuern in England leben. Die Immobilienpreise sind explodiert. Der Kunstmarkt ist völlig aus den Fugen geraten, weil alle großen Galerien in London vertreten sind – auch solche, die ihren Stammsitz in Amerika oder Zürich haben, wie Gagosian, Hauser & Wirth, Pace und Gladstone. Die Kunstszene hat sich komplett verändert.
Es geht heute nur noch ums Geld, nicht um die Kunst, und genau das ist das Problem. Melanie Gerlis hat ein Buch mit dem Titel „Art as an investment? A survey of comparative assets“ (Kunst als Investment? Anlageformen im Vergleich) geschrieben. Auch Don Thompsons „The Supermodel and the Brillo Box“ (Das Supermodel und die Brillo-Schachtel) ist sehr interessant. Wenn man das liest, wird einem klar: Es geht ausschließlich ums Geld. Nicht dass den Menschen Kunst nicht gefallen würde, aber sie sehen sie als Luxusgut, setzen sie mit barem Geld gleich. Früher haben sie an der Börse spekuliert, aber heute erzielen sie nicht mehr die gleichen Gewinne. Und alternative Anlageformen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren.
Natürlich, aber ich denke doch, dass sich die Kunst, die ich kaufe, von jener der spekulativen Sammler unterscheidet: Sie kaufen Warhols, Stingels und Christopher Wools … Die Preise sind wie verrückt in die Höhe geschnellt. Ich habe 2004, also vor nicht allzu langer Zeit, einen Wool um 50.000 US-Dollar erstanden. Heutzutage bekommt man für einen mittelmäßigen Christopher Wool 1,5 Millionen Dollar! Mir ging es beim Kauf nicht ums Geld. Meine moderne britische Kunst ist wertbeständig. Man will sie nicht verkaufen, sondern ansehen. Aber auch hier kommt Bewegung in den Markt, weil die Leute immer mehr Interesse an Kunst aus verschiedenen Ländern haben. Francis Bacon, Lucian Freud, David Hockney – große britische Künstler, die alle hoch im Kurs stehen.
Er macht, was sonst keiner macht: Er produziert Massenkitsch, Haushaltsprodukte für den Alltag, und bläst sie auf. Die Arbeit daran dauert Jahre. Es ist keine Kunst für jedermann, weil nicht viele Menschen bereit sind, sieben Jahre auf ein Kunstwerk zu warten. Der Reiz daran liegt auf der Hand: Man braucht sich nur „Popeye“ anzusehen. Ich stehe auf die Sachen, die mich an etwas erinnern, was ich als Kind mochte. Er spielt mit der Kindheit, spielt mit allem.

Um ehrlich zu sein, ich mag gegenständliche Kunst. Ich mag Menschen. Dazu zählen zum Beispiel Arbeiten von Künstlern wie Thomas Schütte, Paula Rego oder William Roberts – einem wunderbaren, aber stark unterschätzten britischen Künstler, der jetzt immer stärker nachgefragt wird.
Mein Kompagnon Nicolai Frahm und ich wollten nicht zu viel von meiner Sammlung zeigen; das wäre platt gewesen. Wir haben das schon einmal in der Galerie Initial Access in Wolverhampton so gemacht. Das Programm sollte stimmiger und leichter zu kuratieren sein. Wir haben mit John Armleder begonnen, einem Schweizer Künstler, der in den 1980ern groß rauskam. Wäre er Amerikaner, würden seine Arbeiten zehnmal so viel kosten. Unsere nächste große Ausstellung widmet sich Yoshitomo Nara. Unser Vorteil: Wir können alles spontan machen, während große Museen Jahre im Voraus planen müssen.
In meinen Augen haben wir die beste Location in London: Sie ist kein White Cube und nicht so steril wie eine Galerie, sondern hat einen gewissen Industrie-Touch. Wir haben ein Lehrprogramm, das großen Anklang findet; und wir bringen Dinge nach London, die es dort – abgesehen von der Tate Modern und der Royal Academy – nicht zu sehen gibt. Auch von Charles Saatchis Galerie unterscheiden wir uns.
Ich habe ein kollegiales Verhältnis zu Charles, hatte ich immer. Er war stets ein Vordenker, aber heute wird nach anderen Regeln gespielt. Es kostet ein Vermögen, seine Galerie zu betreiben. Er macht etwas völlig anderes als wir; wir sind wie Tag und Nacht.
Die Richard-Hamilton-Retrospektive. In meinen Augen war dort das Beste zu sehen, das Groß-britannien zu bieten hat. Man hatte den Eindruck, dass britische Kunst keineswegs weg vom Fenster ist. Es gibt heute keine Hamiltons zu kaufen, man bekommt sie nicht einmal zu sehen. Ich war total von den Socken. Ich habe schon hunderte gute Ausstellungen gesehen: Picasso, Basquiat … allesamt hervorragende Techniker. Aber bei Hamilton steckt mehr Herzblut dahinter.
Je älter du wirst, desto weniger willst du haben. Wenn ich ein paar Hamiltons hätte und ein paar Schüttes –
ich stehe auf Thomas Schütte! – und dazu einen Picasso, einen Bacon, vielleicht einen Rothko und einen Jackson Pollock, dann würde ich die behalten und auf den Rest verzichten.
Der Bestand soll möglichst schrumpfen, nicht größer werden. Das Sammeln bringt Probleme mit sich: Wenn du stirbst, geht alles an deine Kinder oder an Museen … Weniger ist mehr! Ich für meinen Teil will nur noch Meisterwerke haben. Aber ich schaue mir trotzdem noch junge Künstler an und kaufe auch. Man will ja immer am Ball bleiben!