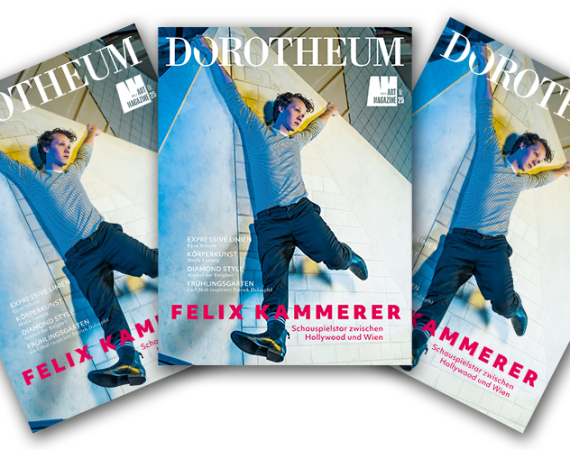Die Auktion Möbel, Antiquitäten, Glas & Porzellan am 24. April 2025 präsentiert in über 290 Lots bedeutende Objekte vom 15. bis zum frühen 20. Jahrhundert.
Meisterhaft gearbeitet, von musealer Qualität und adeliger Provenienz: Dieser Empire-Damenschreibsekretär wird dem Wiener Ebenisten Johann Gallmayer zugeschrieben. Im Vizcaya Museum in Miami findet sich ein vergleichbares Stück, dessen Entwurfsplan im Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste in Wien auf 1810/20 datiert wird. Der vorliegende Sekretär zeigt jedoch eine noch aufwendigere und ausgereiftere Ausführung – möglicherweise ist er das Meisterstück Gallmayers von 1822/23. Mit den für Wien typischen feuervergoldeten Bronze-Zierbeschlägen verkörpert er höchste Handwerkskunst der Empirezeit.
Drei extrem seltene Birnkrüge aus der Werkstatt des Hafnermeisters Thomas Obermillner, Salzburg um 1690: Sie gehören zu den wenigen Beispielen frühbarocker Fayencekunst aus dem Alpenraum. Die Fayencen dieser Werkstatt zeichnen sich durch eine unvergleichbare eigene Dekorsprache aus – charakteristisch dafür sind die blau-grünen Wellenbänder, die die Oberfläche in mehrere Felder teilen, in denen verschiedene Motive anzufinden sind. In den unregelmäßig gegliederten Reserven dieser drei Krüge finden sich farbig gemalte Jagdszenen mit Jägern, Hunden, Wildtieren und floralen Elementen. Savonahenkel, Zinnstandringe und gravierte Zinndeckel mit Monogrammen ergänzen die Ausführung. Entstanden sind die Stücke vermutlich nach dem Tod Thomas Obermillners, als seine Witwe Martha gemeinsam mit Hans Stockhpaur die Werkstatt fortführte. Die Krüge stammen ursprünglich aus der Sammlung Oskar Bondy – einem österreichischen Unternehmer und bedeutenden Kunstsammler
Ebenfalls aus der Sammlung Bondy stammt diese ungewöhnliche Vase von rarer Ausführung: Die um 1725 entstandene Porzellanvase aus der Wiener Manufaktur Claudius Innocentius Du Paquier zeigt einen schlanken Korpus mit reliefierten Akanthusblättern und einen farbig staffierten Drachen, der auf der Schulter sitzt und sich um den Hals windet. Der untere Wandungsbereich ist mit gestanzten kleinen Kreisen versehen, während die Schulter, der Hals und der Bereich unterhalb der Akanthusblätter mit sogenannten „indianischen“ Blütenzweigen in Eisenrot, Grün, Hellviolett, Gelb, Braun und Gold bemalt sind. Die Form geht auf ein chinesisches Vorbild zurück und spiegelt die Strömung zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Europa wider, Porzellan nach ostasiatischen Vorlagen zu gestalten: Altbekanntes wurde mit neuen Formen kombiniert – geschaffen zur Präsentation im barocken Rahmen. Von diesen Drachenvasen – vermutlich ursprünglich Teile von Garnituren – sind heute überhaupt nur noch neun Exemplare bekannt. Es wird angenommen, dass Du Paquier mindestens vier solcher Garnituren fertigte. Eine nahezu identische Vase befindet sich im Metropolitan Museum of Art in New York. Claudius Innocentius Du Paquier, ursprünglich Hofkriegsagent, erhielt 1718 von Kaiser Karl VI. das exklusive Privileg zur Porzellanherstellung in Wien. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten etablierte sich seine Manufaktur rasch als eine der bedeutendsten europäischen Produktionsstätten mit eigener künstlerischer Handschrift.
Die um 1770 in Süddeutschland gefertigte Horizontaltischuhr stammt von Xaveri Liebherr, einem der wenigen namentlich bekannten Uhrmacher im Allgäu. Das feuervergoldete Bronzegehäuse ruht auf drei gedrehten Füßen und ist mit sechs rund eingelassenen Glasfronten ausgestattet – eine raffinierte Gestaltung, die das Innere sichtbar macht. Die Uhr verfügt über eine Weckfunktion sowie ein fein gearbeitetes Gehwerk mit Kette und Schnecke, das eine gleichmäßige Kraftübertragung sicherstellt. Die Kette verbindet das Federhaus mit der spiralförmig aufsteigenden Schnecke, die den Spannungsverlust der Feder ausgleicht: Ohne diesen Mechanismus würde die Uhr beim Vollaufzug zu schnell und gegen Ende zu langsam laufen. Bemerkenswert ist der Erhaltungszustand mitsamt originalem Lederetui und passendem Schlüssel.
Franz Xaver Liebherr wurde 1725 in Konstanz geboren und ließ sich 1766 in Immenstadt nieder. Er wurde in der Werkstatt Mahler ausgebildet, einer bekannten Handwerkerdynastie. Während seiner Wanderschaft verfeinerte er seine Fähigkeiten und arbeitete möglicherweise auch bei dem berühmten Automatenkonstrukteur Jaquet-Droz in der französischen Schweiz. Bekannt wurde er insbesondere für seine Turmuhren, darunter die Werke für die Basilika St. Alexander und Theodor in Ottobeuren (1771) sowie die Konventuhr von 1773 mit mehreren Ziffernblättern im Kloster.
AUKTION
Möbel, Antiquitäten, Glas & Porzellan, 24. April 2025, 13 Uhr
Palais Dorotheum, Dorotheergasse 17, 1010 Wien